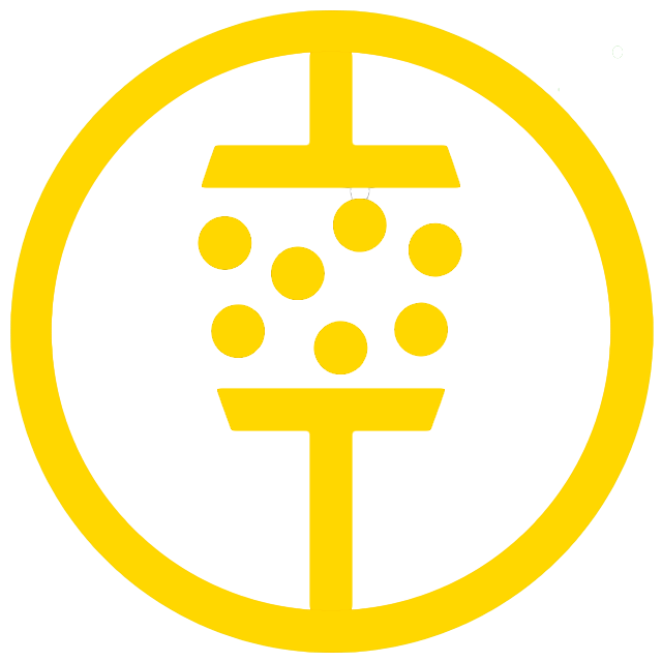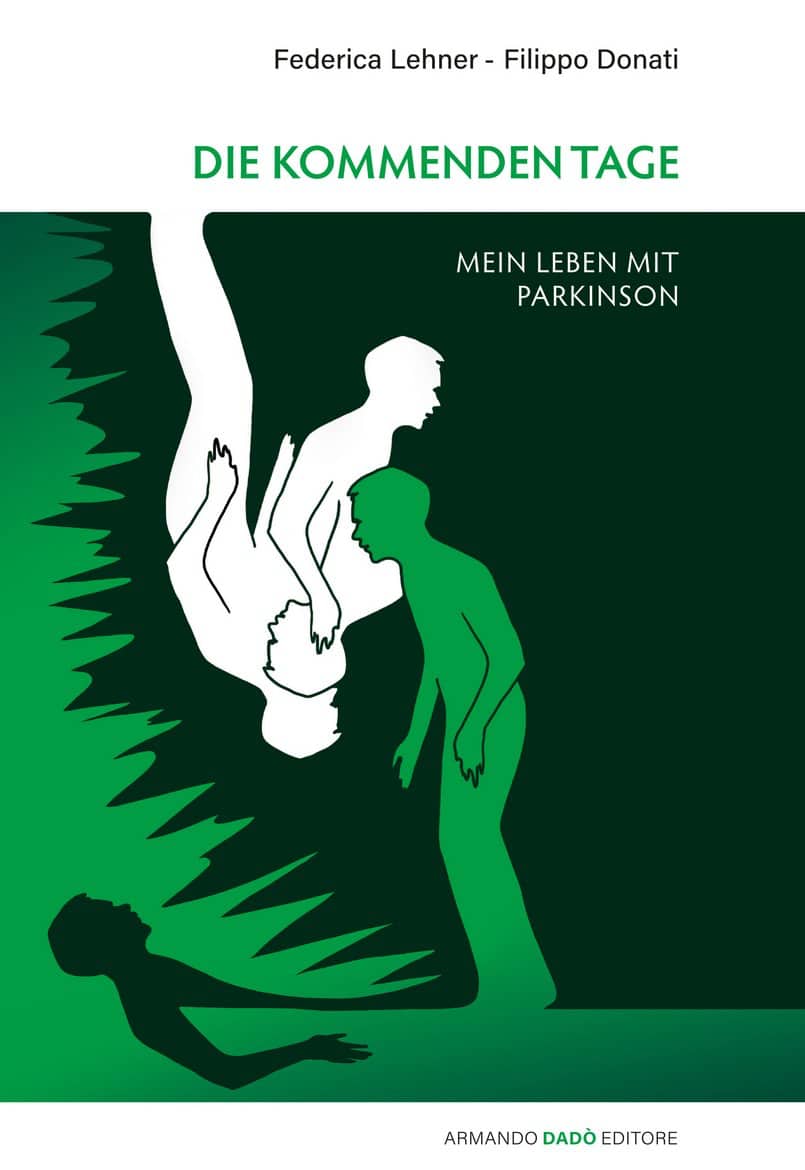Der pensionierte Neurologe und Chefarzt Filippo Donati behandelt Parkinson-Kranke. Dann bekommt er selbst die Diagnose.
«Ich weiss nicht, wie die kommenden Tage aussehen werden, wahrscheinlich werden sie nicht die Besten sein… Ich aber bin entschlossen, das Beste aus dem, was das Leben für mich bereithält zu machen».
Das kürzlich erschienene Buch beschreibt auf eindrückliche Weise die Parkinson-Krankheit aus der Sicht des Patienten wie auch der Pflegenden. Der Erzähler, selbst Neurologe, schildert die Entwicklung der Krankheit, seine emotionalen und familiären Erfahrungen wie auch die Schwierigkeiten in Alltag.
Der eigentlich «medizinische Roman» berichtet auf ungewöhnliche Art über die Parkinson-Krankheit. Die wissenschaftlichen, medizinischen, neurologischen sowie psychologischen Beiträge wurden von 7 zeitgenössischen Schweizer Künstlern illustriert.
Autorenschaft
Federica Lehner, Schriftstellerin, wurde in Lugano geboren, wo sie nach dem Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Genf 1981 das Anwaltspatent erwarb. Federica hat mit ihrem Diplomaten-Ehemann in zahlreichen Ländern gelebt. 2011 schloss sie sich in Kanada einem Autoren-kollektiv an, mit dem bisher drei Romane und eine Sammlung von Kurzgeschichten auf Französisch veröffentlicht wurden.
Filippo Donati, Neurologe, ist in Lugano geboren und aufgewachsen. Er studierte Medizin an der Universität von Lausanne. Er spezialisierte sich zunächst auf Neuropädiatrie und dann auf Neurologie an den Universitätsspitälern Lausanne, Bern und Boston. Er war 20 Jahre lang Chefarzt der Neurologie am Spitalzentrum Biel. Er ist Initiator und treibende Kraft des Projekts „Freunde des medizinischen Romans“ und Herausgeber der neurologischen Beilagen.
Das Buch ist in drei Sprachen erschienen.
Deutsch: Die kommenden Tage, Armando Dadò Editore, 106 Seiten ISBN: 978-88-8281-710-7
Französisch: Les jours ä venir, Armando Dadò Editore, 105 Seiten, ISBN: 978-88-8281-711-4
Italienisch: I giorni che verranno, Armando Dadò Editore, 105 Seiten, ISBN: 978-88-8281-692-6
Das Buch ist zum Preis von CHF 20.- unter folgender Adresse erhältlich: Filippo Donati () Präsident von ARME (Associazione Amici Romanzo MEdico, Verein Freunde des medizinischen Romans), Brunnadernstr. 29, 3006 Bern
Auszüge aus einem Gespräch mit der NZZ Reporterin Andrea Spalinger, veröffentlicht in der Neuen Zürcher Zeitung vom 17.01.2026
Zusammen mit der Autorin Federica Lehner hat Filippo Donati das Buch «Die kommenden Tage» publiziert, in dem er den Alltag mit Parkinson schildert und über den Umgang mit der Krankheit und die damit verbundenen Tabus reflektiert.
[…]
Sie schreiben in Ihrem Buch, es sei für Parkinson-Patienten besonders wichtig, den richtigen Arzt zu finden. Wieso?
Parkinson ist eine komplexe Krankheit. Die Symptome können sehr unterschiedlich sein. Der Arzt muss mit einem Team aus verschiedenen Spezialisten zusammenarbeiten. Und der Patient muss sich ihm anvertrauen können. Denn gewisse Symptome sind unangenehm, wie etwa höherer Speichelfluss, Inkontinenz oder Albträume. Viele Betroffene sprechen nicht darüber. Ich rede mit meiner Ärztin über Dinge, über die ich nicht einmal mit meiner Frau spreche.
Eine Krankheit mit ganz unterschiedlichen Symptomen und Verläufen
Bei Parkinson sterben Nervenzellen im Gehirn ab, die den Botenstoff Dopamin produzieren, der wichtig für den Bewegungsapparat ist. Dies führt zu typischen Symptomen wie Zittern, Schlurfen und anderen motorischen Einschränkungen. Dopamin fehlt aber auch im Magen, in der Leber und überall im Körper. Die Patienten können deshalb oft gleichzeitig an verschiedenen Beschwerden wie Inkontinenz, chronischen Magen-Darm-Problemen, Muskelschmerzen, Sehstörungen, Müdigkeit, Depressionen leiden.
[…]
Haben Sie als Arzt verstanden, was in Ihren Patienten vorging?
Nein, erst als Patient wurde mir klar, mit wie viel Scham diese Krankheit gelebt wird. Heute weiss ich, dass die bekanntesten neurologischen Symptome wie eine zittrige Hand oder der steife Gang für die Betroffenen nicht unbedingt die Hauptprobleme sind. Die psychischen Probleme, die Ängste, die mit der Krankheit einhergehen, empfinden die meisten Patienten als schlimmer. Doch darüber sprechen viele nicht.
Worüber zum Beispiel?
Unter den häufigsten Beschwerden sind Depressionen, sie führen zu Traurigkeit, Energieverlust, Tagesmüdigkeit. Viele Patienten werden auch reizbarer oder erleben starke Stimmungsschwankungen. Schlafprobleme sind bei Parkinson weit verbreitet. Es können aber auch Angstzustände auftreten und in einigen Fällen auch Halluzinationen oder Wahnvorstellungen.
[…]
Sie sind seit vierzig Jahren mit Ihrer Frau zusammen. Wie erzählt man dem geliebten Menschen, dass man eine schwere Krankheit hat?
Ich erwähnte im ersten Gespräch die positiven Aspekte: Man stirbt nicht an Parkinson, und man kann mehrere Jahre lang fast beschwerdefrei damit leben. Ich sagte meiner Frau nicht gleich, dass ich am Ende pflegebedürftig sein würde. Das habe ich früher auch bei meinen Patienten so gemacht. Ich finde es wichtig, das Gegenüber nicht zu überfordern. Man muss Betroffene und Angehörige in kleinen Schritten auf die möglichen Folgen vorbereiten. Und man muss Dinge immer wieder erklären, denn die meisten können im Stress nur einen Teil der Informationen absorbieren.
Wie reagierte Ihre Frau?
Gut. Sie ist eine starke Person und praktisch veranlagt. Sie versuchte sofort, Lösungen für Probleme zu finden, die künftig auftreten könnten. Ich hätte sie gerne gefragt, ob sie mich mit anderen Augen sehe, seit sie wisse, dass ich krank sei. Aber aus Angst vor der Antwort habe ich es sein lassen.
Sie schreiben in Ihrem Buch selbstkritisch, dass Sie besser hätten kommunizieren müssen mit Ihrer Frau und Ihren zwei Kindern.
Ich habe über vieles nicht gesprochen. Über die Angstzustände zum Beispiel. Ich hatte selbst Mühe, zu akzeptieren, was mit mir passierte. Mein Sohn und meine Tochter dachten, ich hätte ihnen etwas verheimlichen wollen, dabei wollte ich sie nur nicht beunruhigen.
Sind Sie heute offener?
Wir sprechen in der Familie wenig über meine Krankheit und darüber, was unweigerlich auf uns zukommt. Es gibt so viele Unbekannte, deshalb finde ich es sinnlos, zu spekulieren. Und ich will auch nicht, dass wir nur noch über meine Krankheit reden. Ich möchte nicht, dass die Menschen in meinem Umfeld mich nur noch als Patienten sehen.
Was macht Ihnen als Patient am meisten Mühe?
Dass ich langsam geworden bin – und wenn ich gestresst bin, werde ich noch langsamer. Ich bin auch schnell gereizt, wegen Kleinigkeiten. Meine Frau braucht viel Geduld. Sie kann nicht mehr spontan sagen: «In einer Viertelstunde fahren wir los!» Ich muss im Voraus wissen, wenn wir irgendwohin gehen, und viel Zeit haben, mich bereit zu machen. Anfangs hatte sie Mühe damit. Sie war immer eine aktive Person, sie ist nicht sehr geduldig. Ich verstehe das, ich wäre an ihrer Stelle genauso.
Fühlen Sie sich manchmal beobachtet?
Ja, von meiner Tochter oder von meiner Frau zum Beispiel. Sie wollen verstehen, wie es mir geht. Aber wenn ich an ihren Blicken erkenne, dass sie eine Verschlechterung bemerken, stresst mich das – und dann werden die Symptome stärker. Vor allem die Beziehung zu meiner Frau litt zeitweise unter der Krankheit.
Inwiefern?
Ich merke, dass es meine Frau nervt, wenn ich manchmal schlurfe oder nach vorne gebeugt dasitze. Sie gibt mir auch oft Ratschläge. Sie sucht praktische Lösungen, die es manchmal beim besten Willen nicht gibt. Gleichzeitig spornt mich meine Frau aber auch an. Sie ergreift die Initiative, geht mit mir ins Kino, zu Vernissagen, plant Treffen mit Freunden und Besuche bei den Kindern. Das hilft mir, dem kranken Planeten zu entfliehen, auf dem ich mich manchmal verliere. Ohne meine Familie ginge es mir heute niemals so gut.
In Ihrem Buch betonen Sie, wie wichtig Ehrlichkeit sei. Parkinson-Patienten und Angehörige müssten wissen, was sie in der Zukunft erwarte.
Ja, denn Unsicherheit kann zusätzlich Angst verursachen. Es gibt aber auch Menschen, die möglichst wenig wissen wollen. Das Schwierigste für einen Arzt ist, den Patienten richtig einzuschätzen. Man muss ihm so viel wie möglich erklären, darf ihn aber auch nicht mit unnötigen Informationen beunruhigen. Das ist eine Gratwanderung.
Gerade in der heutigen Zeit, in der jeder im Internet recherchieren kann.
Ja, die Patienten wissen viel mehr als früher. Sie bekommen aber auch viele ungefilterte Informationen, die sie nicht einschätzen können. Sie lesen etwa über mögliche Beschwerden und verstehen nicht, was es heisst, wenn diese selten, äusserst selten oder sehr selten auftreten. Diese Nuancen muss man verstehen. Sonst fixiert man sich auf die schwerstmöglichen Folgen, die kaum je auftreten, statt sich mit den wahrscheinlicheren auseinanderzusetzen.
Fast jeder von uns kennt einen Parkinson-Patienten. Dennoch wissen wir kaum etwas über die Krankheit. Wie kommt das?
Es hat sicher mit der Zurückhaltung der Betroffenen zu tun, über ihre Beschwerden zu sprechen. Aber auch damit, dass es keinen Standard-Parkinson gibt und jeder Verlauf anders ist.
Keiner weiss genau, was auf ihn zukommt?
Statistisch gesehen schon. Aber ja, es gibt keinen typischen Verlauf, jeder hat seine eigene Form von Parkinson. Bei einem Studienkollegen von mir wurde er vor sechs Jahren diagnostiziert, und heute kann er kaum mehr gehen. Ich lebe seit zehn Jahren mit der Krankheit und bin noch relativ gut zu Fuss. Vielleicht geht es noch zwei Jahre so, vielleicht auch zehn. Sicher ist nur, dass ich irgendwann vollkommen unselbständig sein werde.
Wieso wird Parkinson mit so viel Scham gelebt?
Der Betroffene spürt, wie er langsam die Kontrolle über den Körper verliert, und versucht, dies zu verbergen. Ich hatte Phasen, in denen ich plötzlich wie eingefroren war. Aber ich wollte mir keine Blösse geben. Ich war ein erfolgreicher Mann, ein ehemaliger Chefarzt. Ich wollte nicht krank und schwach wirken.
Was ist für Sie die grösste Herausforderung in Ihrem Leben als Patient?
Sich den eigenen Limitationen anzupassen. Ich bin wiederholt gestürzt, weil ich mich überschätzt habe. Ich ging zu schnell oder bewegte mich zu ruckartig und verlor dann das Gleichgewicht. Das ist typisch für Parkinson-Patienten.
Parkinson kann aber auch ganz andere Folgen haben, zum Beispiel zwanghaftes Verhalten.
Ja, Patienten mit Parkinson können eine verminderte Impulskontrolle haben. Das führt zu Hypersexualität, Spielsucht oder impulsivem Essen. Bei mir zeigte es sich vor allem in einer Art Kaufsucht. Wenn ich einen neuen Filzstift brauche, bestelle ich gleich fünf. Und ich habe eine Moto Guzzi gekauft. Motorräder sind meine Leidenschaft. Als ich jung war, hatte ich eins, und ich träumte davon, nach der Pension wieder zu fahren. In den ersten Jahren nach der Diagnose konnte ich das noch. Aber natürlich war es keine vernünftige Anschaffung. Ich bin nur wenige Male gefahren. Seither steht die Moto Guzzi im Schuppen im Garten.
Wie stark kann man den Krankheitsverlauf mit dem eigenen Verhalten beeinflussen?
Disziplin ist wichtig, die regelmässige Einnahme der Medikamente und körperliche Betätigung. Studien zeigen, dass dies den Verlauf verlangsamt. Ich versuche, ein vorbildlicher Patient zu sein. Ich mache jeden Tag Gymnastik, gehe viel spazieren und einmal die Woche tanzen. Ausserdem hilft es, das Gedächtnis zu trainieren, viel zu lesen, ins Kino zu gehen, sich mit Freunden zu treffen. Nach meiner Diagnose musste ich oft an zwei ehemalige Patienten denken, zwei ältere Männer. Der eine war ein positiver Mensch mit vielen Interessen. Er wohnte allein, aber er ging jeden Tag zum Fitness und machte lange Spaziergänge. Er wollte fit bleiben, vor allem auch den Nachbarn zuliebe, die ihn unterstützten. Der andere hatte eine Frau, die sich liebevoll um ihn kümmerte. Aber er war ihr gegenüber aggressiv. Er machte die Übungen nicht, die ihm gutgetan hätten, und redete sich ein, dass sich sein Zustand verschlechtere, auch wenn es gar nicht so war. Die beiden haben die Krankheit sehr unterschiedlich erlebt.
Parkinson führt oft zu Depressionen. Das wirkt sich vermutlich auch negativ darauf aus, wie man mit der Krankheit umgeht?
Ja. Menschen mit Parkinson tendieren dazu, sich zu isolieren, weil sie sich überfordert fühlen. Wenn dann eine Depression dazukommt, isolieren sie sich noch mehr. Ich litt selbst unter Depressionen. Mir fiel es schwer, positiv in die Zukunft zu blicken. Bis ich psychiatrische Hilfe holte. Es ist wichtig, dass Ärzte ihre Patienten auf psychische Probleme ansprechen und mögliche Therapien thematisieren. Studien haben gezeigt, dass Antidepressiva grosse Verbesserungen in der Lebensqualität bringen können.
[…]
Sie nennen sich selbst einen optimistischen Patienten.
Ich habe mir von Anfang an vorgenommen, positiv mit Parkinson umzugehen. Ich will mich von der Krankheit nicht unterkriegen lassen. Aber manchmal bin ich schon traurig, fühle mich allein in einer Welt voller gesunder Menschen. Und dann gibt es auch Phasen, in denen ich wütend bin und mich frage: Wieso gerade ich?
[…]
Was stört Sie am meisten am Umgang anderer mit Ihrer Krankheit?
Es stört mich, dass ich sozial isoliert werde. Wegen Parkinson spreche ich leise. Vor allem gegen Abend bekomme ich eine Fistelstimme. Die Leute nervt das, sie sind ungeduldig. Kürzlich traf ich bei einem Konzert einen alten Bekannten. Er verstand mich nicht recht und ist einfach weggegangen. Das tut weh. Noch schlimmer ist, wenn Leute mit mir reden, als wäre ich geistig beeinträchtigt. Weil meine Bewegungen verlangsamt sind, denken sie, auch mein Hirn sei langsamer.
Was macht Ihnen am meisten Angst?
Dass ich irgendwann pflegebedürftig und völlig von anderen abhängig sein werde. Mit Parkinson ist man im Endstadium körperlich schwerbehindert, intellektuell ist man aber meist noch voll da. Man bekommt alles mit, ohne daran teilnehmen zu können.
Wie bereiten Sie sich auf diesen Moment vor?
Ich erwäge Sterbehilfe. Wenn ich nur noch im Bett liegen und mich nicht mehr bewegen kann, möchte ich nicht mehr leben. Ich habe mit meiner Frau darüber gesprochen. Sie sieht es anders. Solche Fragen sind schwierig für eine Beziehung.
Interview: Andrea Spalinger
Neue Zürcher Zeitung vom 17. Januar 2026